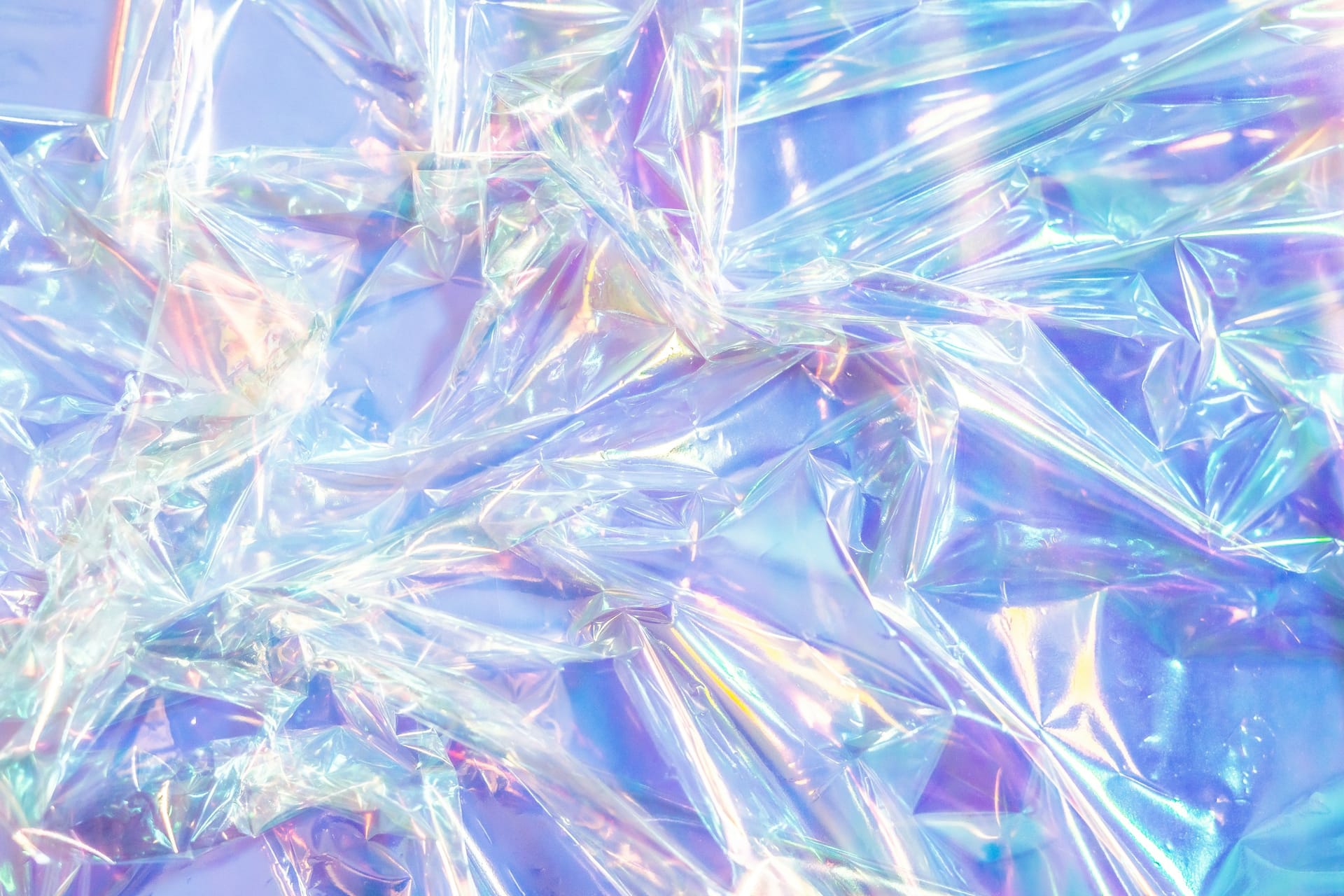Transformation wohin?
Dass heute so viel von Transformation gesprochen wird, jedoch offen bleibt, wohin sie geht, ist gleichursprünglich wie das Gerede von Verantwortung bei dröhnendem Schweigen darüber, auf welche Fragen denn Antworten gegeben werden sollen. Hannah Arendt macht in ihrer Vita Activa den Utilitarismus dafür verantwortlich. Sie argumentiert, dass er kein Prinzip außerhalb der eigenen Logik erlaubt und sich daher solange selbstintensiviert, bis er dogmatisch ist: Wer den Gewinn des Gewinns nicht kennt und nicht zu sagen weiß, wo der Nutzen des Nutzens liegt, ist in einer Endlosrekursion gefangen, einem unendlichen Verweis auf sich selbst. Das Ergebnis ist normative Richtungslosigkeit und kulturelle Substanzlosigkeit, auf der Blendwerk freilich wunderbar gedeiht.

Und natürlich ist auch die Überlast das Ergebnis. Diesbezüglich verhält es sich in der Philosophie wie in der Informatik oder der Biologie: ein infiniter Regress ist selten eine gute Idee. Einen Ausweg aus der Misere werden wir daher nur finden, wenn wir uns eine andere ethische Grundlage geben. Weg von den Oberflächendebatten. Tiefbohrung ist angesagt: in Schulen, Hochschulen und Betrieben. Und damit sind wir zurück bei Goethe:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
Und grün des Lebens goldner Baum.
Ein Rat, der es auf viele Kühlschrankmagnete und Abreißkalender gebracht hat. Doch ist es nicht Goethes Rat, sondern das, wovon Goethe glaubte, dass der Teufel es einem Studenten raten würde.